Gewitter-Blitze der letzten 2 Stunden über Deutschland

Legende:
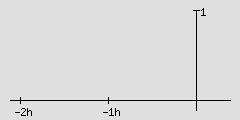
Typen von Gewittern
Gewitter sind auch heute noch die mit am meisten gefürchteten
Wetterphänomene. Mal ganz von den elektrischen Entladungen
abgesehen können diese in Verbindung mit Starkregen,
Hagelschlag und schweren Sturmböen Menschenleben gefährden und
großen Sachschaden anrichten. Umso wichtiger ist es, diese
Naturgewalten rechtzeitig und präzise vorherzusagen.
Das Thema soll aber nicht die gefährlichen Begleiterscheinungen
der Gewitter sein, stattdessen soll es um die verschiedenen
Gewittertypen gehen.
Abhängig vom Auslösefaktor lassen sich Gewitter in Luftmassen-, Front-, Liniengewitter (Squall lines) und Superzellen unterteilen. Bei einer Wetterlage, die von hohen Temperaturen und zunehmender Luftfeuchte geprägt ist, handelt es sich um Luftmassengewitter. Diese bilden sich bei starker Aufheizung einer Luftmasse vom Erdboden her und treten überwiegend am Nachmittag und Abend auf. Man spricht dann von örtlichen Wärme- oder Hitzegewittern.
Häufiger als über dem Flachland findet die Entwicklung eines Wärmegewitters über einem Gebirge statt. Man bezeichnet es dann als orographisches Gewitter. Hier wird die Aufheizung an den in Richtung der Sonne geneigten Berghängen schneller erreicht, als auf einer ebenen Fläche. Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen ist über den Berghängen steiler, sodass hier eine schnellere und auch intensivere Erwärmung erfolgt.
Nun läst aber nicht nur eine starke Aufheizung Gewitter aus, auch an Wetterfronten können sich Gewitter bilden (Frontgewitter). Nach einer langen Wärmeperiode im Sommer ist es normal, dass diese von einem Kaltluftvorstoß mit Kaltfront abgelöst wird. Ein solcher Wechsel vom Wetter fällt selten harmlos aus. Aufgrund der größeren Dichte bzw. Schwere der herannahenden Kaltluft schiebt sich diese keilförmig unter die Warmluft und hebt sie an. Bei ausreichender Schwüle entwickelt sich dann die bekannte Gewitterfront, welche einen Weg von mehreren 100, ja sogar 1000 Kilometern zurücklegen kann. Manchmal bilden sich vor einer Kaltfront in einer Warmluftmasse linienförmige Aneinanderreihungen von Gewitterzellen. Diese bezeichnet man als Liniengewitter oder Squall lines. Die Linien sind bei uns meist von Nord nach Süd ausgerichtet. Ein Entstehungsgrund ist der, dass es im Bereich der wärmsten Luft zu einem verstärkten Aufsteigen der Warmluft und am Boden zu einem vor- und rückseitigen Nachströmen kommt. In der Meteorologie spricht man von einer Konvergenzzone oder Querzirkulation. Die sich in der Konvergenzzone befindliche Squall line entwickelt rasch ein Eigenleben, in dem die von oben einbrechende Gewitterkaltluft die vorgelagerte gewitterträchtige Warmluft erneut zum Heben zwingt. Die Squall line entfernt sich zunehmend von der Kaltfront und zieht durch den Warmluftsektor.
Die "Königin der Gewitter" ist die Superzelle. Aufgrund von Windgeschwindigkeits- und Richtungsänderungen in der Vertikalen und auch Horizontalen innerhalb der Luftmasse kommt es zu einem sich entgegen den Uhrzeigersinn (auf der Nordhalbkugel) rotierenden Aufwindbereich. Solche Gewitter bringen vor allem starken Hagel und auch Tornados und werden besonders im mittleren Westen der USA stark gefürchtet. In Deutschland treten diese Gewitter eher selten auf.
Ob es sich aber bei dem herannahenden Gewitter nun um ein Luftmassen-, Front- , Liniengewitter oder gar eine Superzelle handelt, spielt nur eine Nebenrolle, denn gefährlich für Leib und Leben können alle Gewittertypen werden.
PS.
Wissen Sie eigentlich, warum es in den Tropen keine Blitzableiter gibt? Nun, für Erdblitze (Blitz, der von der Wolke bis zum Erdboden reicht) bedarf es eine Wolkenuntergrenze von unter 3000 m. Da die Gewitterwolkenbasis in den Tropen meist oberhalb von 3000 m liegt, sind Erdblitze nahezu ausgeschlossen. Wer also in unserer Heimat fürchterliche Angst vor Blitzeinschlägen hat, sollte nach dieser Information seinen Wohnort wechseln.
Meteorologen Denny Karran, Christoph Hartmann
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Copyright (c)
Deutscher Wetterdienst
Abhängig vom Auslösefaktor lassen sich Gewitter in Luftmassen-, Front-, Liniengewitter (Squall lines) und Superzellen unterteilen. Bei einer Wetterlage, die von hohen Temperaturen und zunehmender Luftfeuchte geprägt ist, handelt es sich um Luftmassengewitter. Diese bilden sich bei starker Aufheizung einer Luftmasse vom Erdboden her und treten überwiegend am Nachmittag und Abend auf. Man spricht dann von örtlichen Wärme- oder Hitzegewittern.
Häufiger als über dem Flachland findet die Entwicklung eines Wärmegewitters über einem Gebirge statt. Man bezeichnet es dann als orographisches Gewitter. Hier wird die Aufheizung an den in Richtung der Sonne geneigten Berghängen schneller erreicht, als auf einer ebenen Fläche. Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen ist über den Berghängen steiler, sodass hier eine schnellere und auch intensivere Erwärmung erfolgt.
Nun läst aber nicht nur eine starke Aufheizung Gewitter aus, auch an Wetterfronten können sich Gewitter bilden (Frontgewitter). Nach einer langen Wärmeperiode im Sommer ist es normal, dass diese von einem Kaltluftvorstoß mit Kaltfront abgelöst wird. Ein solcher Wechsel vom Wetter fällt selten harmlos aus. Aufgrund der größeren Dichte bzw. Schwere der herannahenden Kaltluft schiebt sich diese keilförmig unter die Warmluft und hebt sie an. Bei ausreichender Schwüle entwickelt sich dann die bekannte Gewitterfront, welche einen Weg von mehreren 100, ja sogar 1000 Kilometern zurücklegen kann. Manchmal bilden sich vor einer Kaltfront in einer Warmluftmasse linienförmige Aneinanderreihungen von Gewitterzellen. Diese bezeichnet man als Liniengewitter oder Squall lines. Die Linien sind bei uns meist von Nord nach Süd ausgerichtet. Ein Entstehungsgrund ist der, dass es im Bereich der wärmsten Luft zu einem verstärkten Aufsteigen der Warmluft und am Boden zu einem vor- und rückseitigen Nachströmen kommt. In der Meteorologie spricht man von einer Konvergenzzone oder Querzirkulation. Die sich in der Konvergenzzone befindliche Squall line entwickelt rasch ein Eigenleben, in dem die von oben einbrechende Gewitterkaltluft die vorgelagerte gewitterträchtige Warmluft erneut zum Heben zwingt. Die Squall line entfernt sich zunehmend von der Kaltfront und zieht durch den Warmluftsektor.
Die "Königin der Gewitter" ist die Superzelle. Aufgrund von Windgeschwindigkeits- und Richtungsänderungen in der Vertikalen und auch Horizontalen innerhalb der Luftmasse kommt es zu einem sich entgegen den Uhrzeigersinn (auf der Nordhalbkugel) rotierenden Aufwindbereich. Solche Gewitter bringen vor allem starken Hagel und auch Tornados und werden besonders im mittleren Westen der USA stark gefürchtet. In Deutschland treten diese Gewitter eher selten auf.
Ob es sich aber bei dem herannahenden Gewitter nun um ein Luftmassen-, Front- , Liniengewitter oder gar eine Superzelle handelt, spielt nur eine Nebenrolle, denn gefährlich für Leib und Leben können alle Gewittertypen werden.
PS.
Wissen Sie eigentlich, warum es in den Tropen keine Blitzableiter gibt? Nun, für Erdblitze (Blitz, der von der Wolke bis zum Erdboden reicht) bedarf es eine Wolkenuntergrenze von unter 3000 m. Da die Gewitterwolkenbasis in den Tropen meist oberhalb von 3000 m liegt, sind Erdblitze nahezu ausgeschlossen. Wer also in unserer Heimat fürchterliche Angst vor Blitzeinschlägen hat, sollte nach dieser Information seinen Wohnort wechseln.
Meteorologen Denny Karran, Christoph Hartmann
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Copyright (c)
Deutscher Wetterdienst